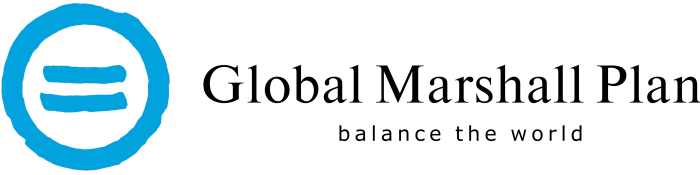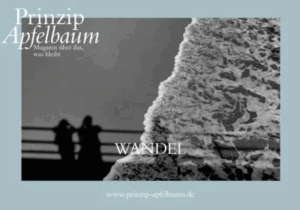„Sei Du selbst die Veränderung, die Du dir wünschst für diese Welt“, forderte Mahatma
Gandhi. Wandel beginnt im Kopf jedes Einzelnen, mit klaren Zielen und der Einsicht, dass
Veränderungen auch positiv sein können. Ein kleiner Funke kann eine ganze Bewegung
entfachen. So kann aus einer Idee Wirklichkeit werden.
Von Angelika Friedl
Wir leben in einem Widerspruch: Einerseits wissen wir genug über Plastikmüll, Waldsterben, Luftqualität und Klimawandel. In einer Studie des Umweltbundesamtes bezeichneten fast zwei Drittel der Befragten den Umwelt- und Klimaschutz als eine der wichtigsten Herausforderungen. Und dennoch begehen wir weiterhin zahlreiche Umweltsünden. So landen beispielsweise noch immer jedes Jahr Tonnen von Lebensmitteln auf dem Müll und der Marktanteil von spritschluckenden SUVs und Geländewagen liegt inzwischen bei über 30 Prozent.
Veränderungen, um Gutes zu bewahren
Die große Frage: Wie können wir unsere über Jahrzehnte gepflegten Gewohnheiten ablegen? Wie können wir die vertrauten Routinen hinter uns lassen und stattdessen neue entwickeln? Leicht ist das nicht. „Wir sind kognitive Faulpelze und ändern unser Verhalten selten“, meint der Transformationsberater Hans Rusinek, der sich auch beim Think Tank 30 des Club of Rome engagiert. Erst wer erkenne, dass Veränderungen nötig sind, um gute Dinge zu bewahren, sei zu einem Wandel bereit. Außerdem sollte man sich positive Ziele setzen. Negative Botschaften wie ‚Ich bewege mich zu wenig, daher steigt mein Risiko für Herzkreislauf-Erkrankungen’ motivieren Menschen nicht. Bin ich hingegen überzeugt, dass mir das Laufen hilft, um zum Beispiel besser zu schlafen, bin ich inspiriert.
Wir haben viel Einfluss – auf uns selbst
Um nicht zu resignieren, kann es helfen, die Perspektive zu wechseln: Auf die großen Zusammenhänge haben wir keinen oder nur sehr begrenzten Einfluss. Was wir aber sehr wohl beeinflussen können, sei unsere Einstellung, meint Rusinek. „Statt den Klimawandel zu einer düsteren Vision werden zu lassen, können wir ihn zu einer besonderen Aufgabe machen.“ Bestärkt hat Rusinek unter anderem eine Studie über kriegsversehrte Veteranen. „Sie zeigte, dass jene am besten weitergelebt haben, die die Kriegsschäden nicht als Ende ihrer Zukunft sahen, sondern als Anfang einer neuen Reise.“
Ein gedanklicher Neuanfang – das ist auch im fortgeschrittenen Alter noch möglich, meint Psychologin Jule Specht von der Berliner Humboldt-Universität. In ihrer Forschung stellte Specht fest, dass unsere Persönlichkeit keineswegs mit 30 Jahren fertig entwickelt ist, wie man lange glaubte. Sie geht davon aus, dass sich jeder Fünfte auch nach dem 60. Geburtstag noch einmal stark verändert. Auslöser sind dabei häufig äußere Veränderungen, wie etwa der Tod des Partners, die eine Anpassung erfordern, aber auch neue Möglichkeiten bieten. Es gehe darum, aktiv zu werden, anstatt passiv zu verharren, wie Specht in ihrem Buch „Charakterfrage“ erklärt. Wer sich selbst verändern will, muss sich neuen Aufgaben stellen
und neue Dinge an sich und der Welt entdecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ohnmachtsgefühle kennen auch „Mächtige“
Angesichts globaler Probleme fühlen wir uns oft machtlos, als kleine Rädchen im Getriebe und übersehen dabei manchmal, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben. Das geht auch Menschen so, die eigentlich über größeren Einfluss verfügen, erzählt der Physiker und Nachhaltigkeitsforscher Thomas Bruhn: „Christiana Figueres, die frühere Direktorin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, schilderte einmal, wie sie sich lange Zeit in ihrer Rolle machtlos fühlte. Es war ein intensiver Prozess für sie, das zu erkennen und schließlich beim Pariser Abkommen eine wirklich gestaltende Rolle anzunehmen.“
Eine Frage der inneren Haltung
Thomas Bruhn leitet am Institut für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam (IASS) das Projekt „A Mindset for the Anthropocene“, was übersetzt in etwa „Geisteshaltung für das Zeitalter
des Menschen“ bedeutet. Es geht um die Frage, welches Bewusstsein wir für einen ökologischen Wandel benötigen. Dazu bringt sein Team Experten aus Wissenschaft, Politikberatung und anderen Disziplinen zusammen. In Workshops werden neben Umweltthemen auch Fragen der inneren Haltung diskutiert, in welchen Bereichen sie wirksam sein und wie sie in einen guten Kontakt kommen können. „Wenn die einen zum x-ten Mal ihren Vortrag halten, während andere ihre E-Mails lesen, kann kein neues Verständnis und vor allem kein verändertes Handeln herauskommen.“ Thomas Bruhn glaubt, dass Wandel nicht allein durch neue Technologien und Politik gelingen kann, sondern dass wir auch Achtsamkeit und Mitgefühl brauchen. „Nur wenn mich der Zustand der Welt
innerlich berührt, werde ich nicht weitermachen wie bisher.“
Eine Minderheit kann etwas bewegen
Eine Zahl, die Hoffnung macht: 3,5 Prozent. Das ist der Anteil einer Bevölkerung, der offenbar nötig ist, um einen politischen Wandel zu erreichen. Erica Chenoweth, Politikwissenschaftlerin an der Harvard University, hat hunderte von Protestbewegungen in den letzten hundert Jahren betrachtet und verschiedene Faktoren für ihren Erfolg gefunden. Bei etwa 3,5 Prozent entsteht demnach eine kritische Masse: So demonstrierten 1986 in der philippinischen Hauptstadt Manila Millionen von Menschen friedvoll für einen politischen Wechsel. Vier Tage später floh Diktator Ferdinand Marcos aus dem Land. Auch kurz vor dem Mauerfall 1989 kamen bei der Montagsdemonstration am 6. November in Leipzig und Dresden insgesamt rund 400.000 Menschen zusammen.
Fokus auf ein klares Ziel
Ein anderer Schlüssel für den Wandel: konkrete Ziele. „Man braucht ein klares Anliegen, um sich fokussiert organisieren zu können“, sagt der Transformationsberater Rusinek. „Gandhis
Protest begann mit dem Marsch gegen die Salzsteuer. Er wollte nicht gleich das Britische Empire abschaffen.“ Schon ein kleiner Funke kann in einer bestimmten Situation eine
größere Bewegung entfachen. Die Proteste vor einigen Jahren in der Türkei begannen mit dem Widerstand gegen ein Bauprojekt im Gezipark in Istanbul.
In Hongkong gingen dieMenschen anfangs gegen ein Gesetz zur chinesischen Rechtshilfe auf die Straße, inzwischen geht es ihnen um die Unabhängigkeit von China. Ein klares Ziel und dazu einen Plan, wie es sich umsetzen lässt – ein Beispiel dafür ist auch die Initiative „German Zero“, zu der sich deutsche Klimaaktivisten, Unternehmer und Wissenschaftler zusammengeschlossen haben. Ende des Jahres legten sie einen eigenen Klimaschutzplan vor, der zeigt, was zu tun ist, damit Deutschland bis 2035 klimaneutral wird. Ein Gegenentwurf zum viel kritisierten Klimapaket der Bundesregierung. Die „Fridays for Future“-Bewegung hat den Stein ins Rollen gebracht, Initiativen wie „German Zero“ zeigen,wie es weitergehen könnte.
Kein Zweifel, beim Thema Nachhaltigkeit sind tiefgreifende Veränderungen nötig, und natürlich Menschen, die sie tragen. Zu denken, wir können unseren Alltag weitermachen wie bisher, solange wir nur die Rahmenbedingungen verändern, greift zu kurz. Der Wandel findet zuerst in den Köpfen statt – und er muss auch umgesetzt werden. Hans Rusinek bringt
es auf den Punkt: „Wandel ist das einzige, was bleibt.“
________________
Von Angelika Friedl
Zuerst erschienen im Onlinemagazin „Prinzip Apfelbaum“, Ausgabe 11.
Alle Artikel und Ausgaben des Online-Magazins finden Sie kostenlos unter: www.das-prinzip-
apfelbaum.de